Die Sprache der Wahrnehmung und Erinnerung
Esther Kinsky im Gespräch mit Jente Azou und Hanne Janssens
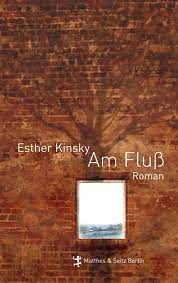
Esther Kinsky ist Autorin und literarische Übersetzerin aus dem Russischen, Polnischen und Englischen (u.a. Lob der Wildnis von Henry D. Thoreau). In ihren literarischen Werken geht es ihr vor allem darum zu benennen, was sie sieht. Mit präzisen und gleichzeitig lyrischen Beobachtungen schildert sie Flächen an den Grenzen zwischen Land und Metropole. 2014 veröffentlichte sie den Roman Am Fluß. Ihr Roman Hain. Geländeroman (2018) erzählt von drei Reisen, die die Erzählerin an abgelegene Orte in Italien führen und wurde mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2018 ausgezeichnet. Ihr jüngster Gedichtband Schiefern (2020) ist dem Sedimentgestein und der postindustriellen Landschaft der schottischen Slate Islands gewidmet.

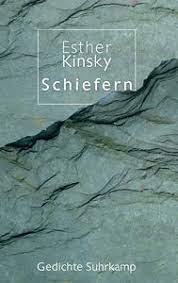
Hanne Janssens: Ihre Werke stellen keine idyllischen, von Menschen unberührten Landschaften dar, sondern zeigen die Verletzungen, die die Menschheit der Umwelt zugefügt hat. Dabei wird eine Darstellung einer Natur, die sich ausschließlich auf der Idealisierung ihrer positiven Charaktereigenschaften begründet verneint. So zeigt Ihr Lyrikband Schiefern postindustrielle, ausgebeuteten Landschaft der schottischen Slate Islands. Welche Rolle spielen die ökologischen Umbrüche in Ihren Werken?
Esther Kinsky: Ich würde nicht sagen, sie „zeigen“ Verletzungen. Ich gehe auf bestehende Versehrungen ein. Was mich interessiert ist das sogenannte „gestörte Gelände”, ein Begriff aus der Naturkunde, der Flächen bezeichnet, in denen sich nach menschlicher Intervention eine bestimmte Art der “Natur” wieder etabliert. Mich interessieren Spuren; Jede vom Menschen verursachte Versehrung ist auch eine Spur menschlichen Leids in Form von Ausbeutung, Not, Armut. Die Menschen, die physisch Hand an diese Orte legten taten es zumeist aus Not. Die Spuren dieser Not interessieren mich genauso wie das, was am Gelände als “natürlichem” Vorgang nach solchen Eingriffen offenbart. Mir liegt alles Ostentative fern. Ich möchte nichts “zeigen”, ich möchte vermitteln, was ich selbst sehe.
H.J.: In Ihrem „Geländeroman“, Hain, bereist die Erzählerin abseitige Ortschaften in Italien. Das Buch erkundet die Verlust- und Trauererfahrungen der Protagonistin, gleichzeitig ist es eine sehr präzise und poetische Beschreibung der Umgebung. Warum haben Sie sich veranlasst gefühlt, den Begriff « Geländeroman » einzuführen? Inwiefern hat er Ihnen geholfen, das Verhältnis von Literatur und Natur neu zu denken? Was verstehen Sie genau unter einem „Gelände“?
E.K.: Ich mag den Begriff und das Genre des „Romans“ nicht, aber bei solchen Bezeichnungen muss man sich den Verlagen beugen, es gäbe ja auch kein Genre für die Art, wie ich schreibe. Ich denke auch nicht das Verhältnis von Natur und Literatur neu; ich schreibe aus dem Sehen heraus, ich bemühe mich um eine Art der Wertfreiheit in der Darstellung, die im besten Fall den Lesern eine neue Sichtweise vermittelt. Gelände ist für mich ein neutrales Wort. Von vielen Lesern habe ich gehört, dass das für sie nicht so ist, aber im Lauf eines Gesprächs darüber stellt sich oft heraus, dass es Zuschreibungen sind, die nichts mit Orten selbst zu tun haben, sondern etwa durch eine politische Färbung des Begriffs „Gelände“ beeinflusst sind. Es gibt also offensichtlich einen Konsens über die Verwendung eines so belasteten Wortes, der mir fremd ist. Doch im Umgang mit Sprache und Wörtern muss man immer wieder neu den Konsens befragen und hinterfragen, und das ist auch ein Grund für mich, so zu schreiben, wie ich es tue.
H.J.: Viele zeitgenössische ökologische Erzählungen greifen Reiseberichte und Beschreibungen von einsamen Aufenthalten an unberührten Orten auf, aus der Tradition des nature writing, von Henry D. Thoreau bis Edward Abbey. Auch Ihre Erzählungen behalten die Suche nach einer tieferen Verbindung mit der Natur: In Am Fluß spaziert die Protagonistin den River Lea entlang, sie überquert Marschländer und Trampelpfaden in einer postindustriellen Landschaft. Die Erzählerin in Hain. Geländeroman unternimmt 3 Reisen durch abseitige italische Gegenden. Mit Ihren weiblichen Beobachterinnen und Fotografinnen, die sich in stark vermenschlichten Umwelten bewegen, scheinen Sie jedoch von dieser Tradition abzuweichen. Wollten Sie auf diese Art und Weise die männlich-autarke Tradition in Frage stellen? Ist das Überdenken der Tradition für Sie ein Mittel, um zu lernen, harmonisch mit der menschengemachten Welt umzugehen?
E.K.: Nein, ich habe keine solchen Motivationen. Auch kenne ich wenige solche idyllischen Erzählungen. Thoreau war mit Walden kein Idyllenschreiber, das ist ein sehr streng didaktisches Buch. Thoreaus wirklich großen Werke sind seine Journals, und denen fühle ich mich schon nah, weil sie wertfrei sind und einfach alles in der Umwelt registrieren. Umwelt ist ja alles, was uns umgibt. Außerdem glaube ich nicht, dass man mit dem Überdenken einer künstlerischen Tradition irgendwohin kommt, was den Umgang mit der Umwelt angeht. Mich interessiert die Umsetzung von Materie, von Gesehenem, Gehörtem, Wahrgenommenem in Sprache, und da suche ich nach Ansätzen, für mich. Mich interessieren Benennungsprozesse. Wie entscheiden wir uns für Wörter, für Benennungen der Dinge, die wir sehen?
Ich gehe gern, ich sehe gern, aber “unberührte” Natur interessiert mich einfach nicht. Mich interessiert die Menschenwelt. Der Mensch hat sich immer mit den Bedingungen arrangieren müssen, die wir “Natur” nennen, und wenn es nur das Wetter ist. Und wo der Mensch war, da ist auch Sprache entstanden, das geht mich viel mehr an als die Natur selbst.
Jente Azou: In Ihren Werken ist nicht nur die Wahrnehmung des Geländes, sondern auch die Bewegung im Gelände von großer Bedeutung. Die Protagonistinnen bewegen sich im Gelände, die Spaziergänge stoßen nicht nur eine genaue Beobachtung der Umgebung an, sie lösen auch Erinnerungen aus. Sind Bewegung und Erinnerung für Sie inhärent miteinander verknüpft? Inwieweit gestaltet Bewegung oder Spazieren den Erzähl- und Schreibprozess?
E.K.: Das Gehen ist für viele Künstler und Schriftsteller sehr wichtig. Es gibt sogar Untersuchungen darüber, dass diese ausgeglichene Bewegung des Körpers, bei der man in stetem Wechsel beide Gehirnhälften aktiviert, solchen Schaffensprozessen förderlich sind. Ich glaube, die Aktivierung von Erinnerung – der Sinnenerinnerung – erfolgt nicht unbedingt beim Gehen aber es werden Prozesse ausgelöst, die auf die eine oder andere Weise unerlässlich für jedes künstlerische Schaffen sind.
H.J.: Das Gelände in Ihren Büchern ist ein genauer Ausschnitt der Wirklichkeit, immer aus dem Blickwinkel einer Beobachterin, aus menschlicher Perspektive. Die Landschaft in Hain spiegelt das Innenleben der trauernden Reisenden wider, auch der River Lea ruft bei der Erzählerin in Am Fluß Erinnerungen hervor. Glauben Sie, dass jede Landschaft in der Literatur eine Betrachterin voraussetzt, dass das menschliche Subjekt immer im Hintergrund präsent ist?
E.K.: Nein, da möchte ich mich gegen verwehren. Die Landschaft in Hain ist kein Widerspiegelung des Innenlebens der Reisenden. Das ist auch in Am Fluß nicht der Fall. Mir wird oft das Aufsuchen und Beschreiben solcher “trostlosen” Gegenden zugeschrieben, aber ich glaube, viele verstehen nicht, dass ich das nicht trostlos finde, und dass auch der Begriff „trostlos“ auf einem usneligen Kosnens über das beruht, was „schön“ oder wohltuend ist. Es sind solche reichen Landschaften, gerade deshalb, weil sie nichts Grandioses enthalten und so mit den Menschen, die sie bewohnen, verwachsen sind.
J.A.: In Ihren neuesten Romanen (Hain und Am Fluß) wird die Protagonistin als Außenseiterin dargestellt: Sie befindet sich in Italien und London an unbekannten Orten, abgesondert von der Bevölkerung vor Ort. Ist diese isolierte Position notwendig für die genaue Wahrnehmung der Umgebung in den Texten? Darüber hinaus interessieren sich die Hauptfiguren in Ihrem Werk auch für andere Außenseiter/innen (insbesondere Migrant/innen). Ist es für Sie wichtig, die oft unerzählte Geschichte der Außenseiter/innen in Ihrem Werk zu schildern?
E.K.: Für mich sind Fremde und Außenseitertum ganz fundamentale Erfahrungen, sie prägen meine Sicht, aber ich habe wie oben schon gesagt keine Absichten, keinen Plan, was ich vermitteln will. Die Figuren entwickeln sich mehr aus dem Schreiben selbst. Das sind dynamische Prozesse, die ihren eigenen Regeln folgen, und ich schreibe auch keine Dokumentationen.

Esther Kinsky
© Yves Noir
H.J.: Die zeitgenössische Literatur zeigt ein weiterhin wachsendes Interesse für die Darstellung des Nicht-Menschlichen, für das, was die konzeptuellen und perspektivischen Kategorien von Menschen übersteigt. Ein besonderes Interesse gilt der Tierwelt. In Ihren Werken imaginieren Sie auch die unbelebte Welt, mit der wir so eng verbunden sind. So beschreiben Sie die Pflanzenwelt sehr genau, mit dem entsprechenden Fachjargon (Sie stellen das Raingebüsch des ländlichen Englands dar – „Hasel, Weißdorn, Ulmen“[1]). In dem Gedichtband Schiefern schildern Sie ein Gelände in Schottland, das nach Schieferabbau völlig versehrt ist. Sie schildern die Gruben, die Schieferstücke und andere Gesteine, die Sie beim Namen nennen (wie Pyrit und Mergel). Glauben Sie, dass Sie als Autorin in der Lage sind, sich aus einem menschlichen Blickwinkel zurückzuziehen, um das Nicht-menschliche zu repräsentieren? Welche Herausforderungen gab es für Sie?
E.K.: Aber ich imaginiere keine unbelebte Welt. Ich beschreibe was ich sehe, Vögel, Pflanzen, Gestein, und dabei interessiert mich sehr die Art und Weise, wie sich Sprachen für die Natur herausgebildet haben. Diese schönen alten Wörter für die einzelnen Teile des Vogelgefieders, der Blumen, das ist ein sehr poetisches Vokabular, mit dem der Mensch ja auch immer und unweigerlich eine eigene Stellung in der Welt definiert. Die Vögel sehen sich ja nicht so, und die Steine erst recht nicht. Gesteine, insbesondere Schiefer, interessieren mich auch deshalb so, weil sie Zeugnisse von Vergangenheit sind, die wir uns kaum vorstellen können, aber wir sind es, die dem einen Namen geben. Natürlich möchte ich mich nicht aus dem menschlichen Blickwinkel zurückziehen, ich bin Mensch, sonst hätte ich keine Sprache, die aus der Distanz zwischen Subjekt und Objekt schöpft.
H.J.: Das lyrische Subjekt taucht in die Landschaft ein, es betrachtet die Umgebung und interpretiert die Dinge, die ihm auf seinen Spaziergängen begegnen. In Ihrem Gedichtband Schiefern erkennt man verschiedene Bedeutungen in den Ablagerungen der Schieferschichten. Außerdem findet man „Lesestücke“[2] in der überrumpelten Landschaft vor, Spuren von Schrifttierchen oder Rostader im Stein, die sich entsprechend „lesen lassen“. Das aufstrebende Feld des material ecocriticism bietet eine Möglichkeit, die Natur selbst als Aktant zu sehen, wobei sowohl die menschliche als auch die nichtmenschliche Welt für handlungsfähig gehalten werden.[3] Kann uns die Natur etwas erzählen oder sogar etwas vorenthalten? Sehen Sie die Natur als handlungsfähig und kreativ?
E.K.: Ich habe darüber noch nie nachgedacht. Aber ehrlich gesagt ist das auch nichts, was mich so interessieren würde. Nur der Mensch kann die Zeichnungen im Stein als “Schrift” sehen, nur der Mensch kann die Steine unter dem Aspekt dieser Vorstellung von Zeit betrachten. “Schrifttierchen” war ein Begriff aus der Geologie übrigens. Ich würde sagen, mir geht es immer “nur” um Aspekte des Verhältnisses von Mensch zur Umgebung, weil es mir immer um Sprache geht.
H.J.: Die ‚Natur‘ in Ihren Werken ist kulturell und technisch weitgehend von Menschen geprägt. Die Protagonistin in Am Fluß bewegt sich in einem Randgebiet Londons und durchquert Streifen der Flusslandschaft an der Grenze zwischen Wildnis und Zivilisation: Sie begegnet einem schütteren Hain „der unscheinbar zwei Welten trennt, von denen man weiß, dass man sich nur einer wird zuschlagen können“ (Am Fluß S. 90). ‚Natur‘ und ‚Kultur‘ scheinen in einer engen Wechselbeziehung zu stehen, für die Donna Haraway den aussagekräftigen Begriff der „NatureCulture“[4] einführte. Glauben Sie, dass wir die Grenze zwischen Natur und Kultur noch ziehen können, oder sollten wir die kategoriale Trennung zwischen beiden neu in Frage stellen?
E.K.: Bei der zitierten Stelle in Am Fluß geht es um etwas ganz anderes, nämlich um Gegenwart oder Vergangenheit in Gestalt von Erinnerung. Will man in der Gegenwart leben, muss man auf einer bestimmten Seite der Dinge (mancher Dinge) bleiben, will man sich ganz Erinnerungen und Vergangenheit hingeben, gehört man auf die andere Seite. Grenzen sind ein Thema, das mich sehr beschäftigt, allgemein, aber nicht zwischen Kultur und Natur. Sobald ein Mensch seinen Fuß irgendwo hinsetzt und etwas benennt, vollzieht er schon eine kulturelle Appropriation, und überführt so Natur in Kultur.
H.J.: Die abseitigen oder auch verzerrten Landschaften scheinen sich in der Form Ihrer Werke widerzuspiegeln. Die formalen Mittel, die benutzt werden, um die Verbindung zwischen Mensch und Natur zum Ausdruck zu bringen, interessieren mich sehr. In Ihren Gedichten verwenden Sie zum Beispiel viel Riss- und Knackläute, die das ergatterte und verzerrte Gelände erklingen lassen. Auch in Ihren Romanen verwenden Sie eine poetische Sprache. Überdies scheint Fotografie eine wichtige Rolle zu spielen. Kann ich daraus schließen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, sich der Natur zu nähern? Gibt es Ihres Erachtens eine Gattung, die am besten für die Erforschung ökologischer Vorstellungswelten geeignet ist?
E.K.: Nein, ich kann mir kein Urteil über Gattungen erlauben. Ich glaube, die lautliche Gestaltung gehört zu jedem Text. In Schiefern geht es sehr viel um Hörbares, nicht nur das Gesehene. Der Gegenstand verlangt nach einer bestimmten lautlichen Gestaltung, damit bin ich sicher nicht allein, Rhythmus, Ton, das alles gehört doch zum Schreiben dazu.
J.A.: Ihre Arbeit setzt sich ausführlich mit Fotografie auseinander. Sowohl der Produktionsprozess als auch die Wahrnehmung von Fotos ist in den Texten thematisiert. In manchen Werken (z. B. Hain) werden die Gestaltung und Wahrnehmung von Bildern nur beschrieben, in anderen Texten (z. B. Am Fluß und Schiefern) enthält der Text sogar Bilder. Worauf stützt die Entscheidung, die Bilder entweder nur zu beschreiben oder auch tatsächlich in den Text einzufügen? Gibt es für Sie einen radikalen Unterschied zwischen einer textuellen Beschreibung eines Bildes und einer visuellen Einfügung eines Bildes in den Text, oder sind die Medien (Text und Bild) inhärent miteinander verknüpft?
E.K.: Ja, das Fotografieren ist für mich ein wichtiger Schritt, weil es eine Phase zwischen Sehen, Erkennen und Wort festhält, die mich sehr beschäftigt. In Am Fluß ging es um die Polaroids – die Fotos sind alle diese etwas lädierten Polaroids, die unscharf sein sollen. Da geht es ja um ein Überraschungselement, dass diese Bilder so anders sind als der durch den Sucher wahrgenommene Ausschnitt. Uns generell geht der Text ja auf die Bedeutung der Begegnung des Fotografierenden mit dem Foto als etwas Neuem, Absolutem und nicht mehr dem Ausschnitt ein.
Für mich können Text und Bild immer nur zwei voneinander getrennte Stränge sein. Sie dürfen nie als gegenseitige Illustration funktionieren. Sie sind zwei Seiten. Mit der Beschreibung des Fotos in Schiefern habe ich zum ersten Mal etwas versucht, was mich beschäftigt: nämlich die Übersetzung eines Bildes in Sprache. Ich wollte das Bild nicht im Buch haben, das hätte nicht gepasst, aber ich wollte es in Worte fassen. Das ist für mich ein interessanter Prozess, ich weiß noch nicht genau, warum.
Diesen Artikel zitieren:
Jente Azou, Hanne Janssens, Esther Kinsky : Die Sprache der Wahrnehmung und Erinnerung. Esther Kinsky im Gespräch mit Jente Azou und Hanne Janssens, Literature.green, April 2021, URL: https://www.literature.green/die-sprache-der-wahrnehmung-und-erinnerung-esther-kinsky/, (abgerufen Datum).
—————————————————————————————————————————————————–
[1] Esther Kinsky: Am Fluß. Berlin: Matthes & Seitz, 2014, S. 88.
[2] Esther Kinsky: Schiefern. Berlin: Suhrkamp, 2020, S. 21.
[3] Serenella Iovino und Serpil Opperman: Material Ecocriticism. Bloomington: Indiana University Press 2014.
[4] Donna Haraway: The companion species manifesto. Dogs, people, and significant otherness. Chicago: Prickly Paradigm Press (=Paradigm) 2003, S. 2.
